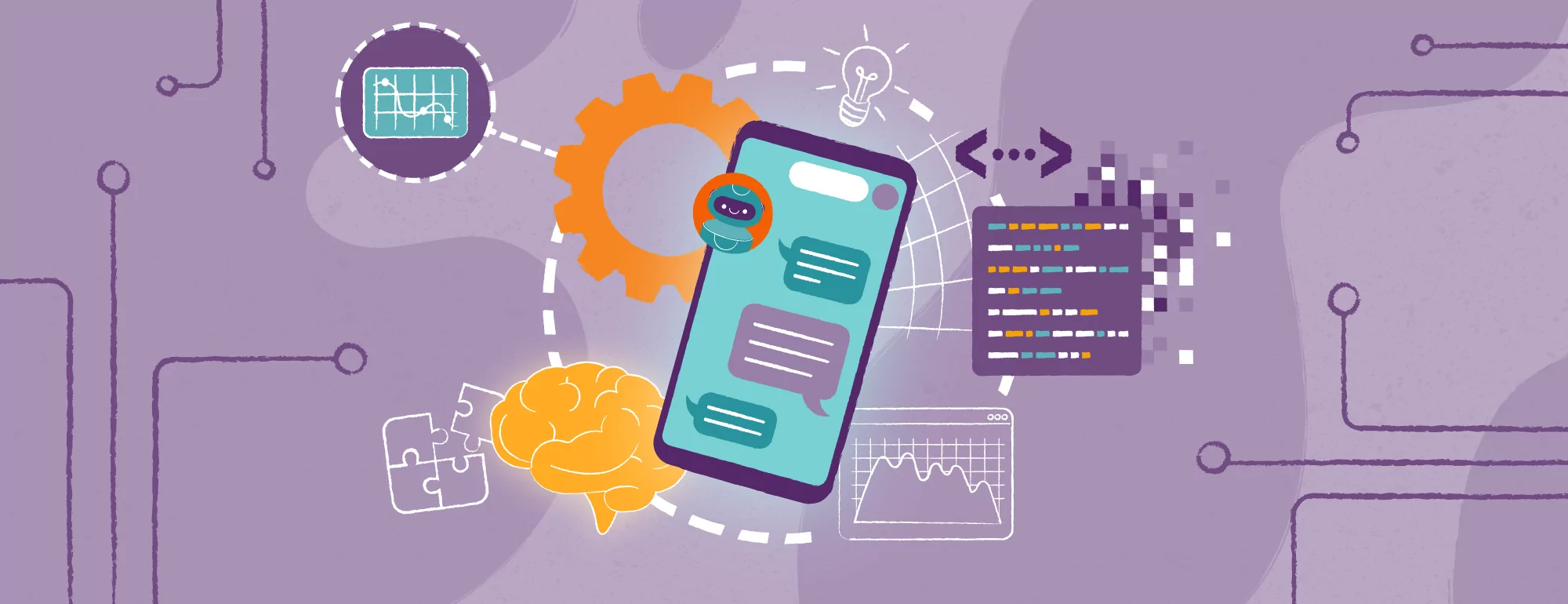Digitale Lösungen und neue Chancen für Menschen mit Behinderungen / ESG in der Praxis am Beispiel von SIG
Arbeit ist nicht nur eine Quelle des Lebensunterhalts, sondern auch eine Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung, zum Aufbau von Beziehungen und zur Mitgestaltung der Umwelt. Für viele Menschen bleibt der Zugang zu dieser Welt jedoch nach wie vor eingeschränkt – nicht wegen mangelnder Kompetenzen, sondern aufgrund von Barrieren auf dem Arbeitsmarkt. Inklusion ist ein häufiges Gesprächsthema, wird aber seltener wirklich umgesetzt. Veränderung beginnt jedoch im Alltag – bei der Teamzusammenstellung ebenso wie bei der Wahl der Werkzeuge.
Das Unternehmen SIG zeigt, dass sich durch ESG, Technologie und Empathie ein Arbeitsumfeld schaffen lässt, das Vielfalt willkommen heißt.
ESG als gelebter Wert – nicht nur als Strategie
ESG beschreibt ein Geschäftsmodell, das Verantwortung gegenüber Umwelt (E – Environmental), Gesellschaft (S – Social) und Unternehmensführung (G – Governance) übernimmt. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass das „S“ nicht als weiches Element verstanden werden darf, denn genau hier liegen Themen wie Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion.
Inklusion in der Praxis bedeutet mehr als Chancengleichheit. Es geht darum, Räume aktiv zu gestalten, in denen jeder Mensch – unabhängig von Einschränkungen, Herkunft oder individuellen Bedürfnissen – tatsächlich am Berufsleben teilnehmen kann. Im Unternehmenskontext heißt das: Arbeitsplätze, Prozesse und Unternehmenskulturen so zu gestalten, dass sie die Präsenz von Menschen mit besonderen Bedürfnissen nicht nur zulassen, sondern ausdrücklich fördern und wertschätzen.
In einer Welt, in der der Ausschluss vom Arbeitsmarkt oft durch physische, soziale oder systemische Barrieren entsteht, kommt den Unternehmen eine entscheidende Rolle zu. Arbeitgeber können und sollten als Impulsgeber des Wandels agieren. Von ihnen hängt es ab, ob Vielfalt ein echter Vorteil der Teams wird oder nur ein Schlagwort in der Unternehmenskommunikation bleibt.
Barriere oder Chance? Der Arbeitsmarkt und Menschen mit Behinderungen
In Polen ist die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinderungen noch immer deutlich geringer als der Landesdurchschnitt. Laut dem Statistikamt GUS sind nur etwa 30% der Personen mit einer anerkannten Behinderung berufstätig. Das bedeutet nicht, dass die übrigen nicht arbeiten wollen – in vielen Fällen liegt die Hürde im Umfeld, nicht bei der Person selbst.
Es lassen sich drei Hauptarten von Barrieren unterscheiden:
- Physische Barrieren – fehlende barrierefreie Infrastruktur, Zugänge, Aufzüge oder ergonomische Arbeitsplätze,
- Mentale Barrieren – Stereotype, Ängste und fehlendes Wissen bei Arbeitgebern und Kollegen,
- Systemische Barrieren – komplizierte Vorschriften und erschwerter Zugang zu institutioneller Unterstützung.
Die fortschreitende Digitalisierung und flexible Arbeitsmodelle verändern jedoch die Spielregeln. Automatisierte Prozesse oder digitale Datenmanagementsysteme ermöglichen eine ausgewogenere Verteilung von Aufgaben und eine Anpassung der Arbeit an die individuellen Fähigkeiten der Mitarbeitenden.
Für Organisationen, die diese Herausforderungen als Chancen begreifen, eröffnet sich enormes Potenzial. Menschen mit Behinderungen sind oft äußerst loyale, engagierte und gewissenhafte Mitarbeitende – vorausgesetzt, sie erhalten die passenden Werkzeuge und Rahmenbedingungen.
Das Beispiel SIG – wie Technologie Inklusion fördert
SIG arbeitet konsequent daran, Barrieren abzubauen und den Zugang für Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Das Unternehmen engagiert sich aktiv gegen Stereotype und gesellschaftliche Grenzen. Ziel ist es, künstliche Trennlinien zu überwinden und Integration sowie Gleichberechtigung zu fördern.
Bartosz Pilch, Group Director of Omnichannel bei SIG, setzte beim Aufbau der E-Commerce-Plattform auf ein stabiles, modernes und vielfältiges Team, das auf gegenseitigem Vertrauen basiert. Entscheidendes Kriterium sind Kompetenzen – unabhängig von Alter, Geschlecht oder Weltanschauung. Auch Menschen mit Behinderungen sind Teil des Teams und erhalten bei SIG gleiche Chancen.
In den Bereichen E-Commerce, Marketing und Kundenservice arbeiten derzeit rund 30 Mitarbeitende mit unterschiedlichen Behinderungen – das sind etwa 80% des gesamten Teams. Ihre Aufgaben reichen von Hotline- und Vertriebspositionen über Fach- bis hin zu Führungsrollen.
„Durch die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen haben wir äußerst loyale und kompetente Mitarbeitende gewonnen“, sagt Bartosz Pilch. „Unsere Kolleginnen und Kollegen, die zuvor keine Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderungen hatten, sind viel offener geworden. Es war für uns alle eine große Lektion. Wir haben gelernt, wie man respektvoll miteinander umgeht. Diese Erfahrung hat uns als Unternehmen sozial sensibler gemacht. Vielfalt, einschließlich der Einbindung von Menschen mit Behinderungen, ist für mich von zentraler Bedeutung.“
Im Jahr 2022 erhielt SIG die Auszeichnung „Arbeitgeber mit Herz“. Der Titel würdigt das soziale Engagement des Unternehmens, seinen Beitrag zur Erhöhung der Beschäftigungschancen für Menschen mit Behinderungen sowie den Abbau von Diskriminierung und gesellschaftlichen Barrieren. Ziel der landesweiten Kampagne ist es, Arbeitgeber zusammenzubringen, die Menschen mit Behinderungen beschäftigen, und ihr gesellschaftliches Engagement sichtbar zu machen.
Verständnis und individuelle Herangehensweise
Auch Menschen mit Zerebralparese stehen vor besonderen Herausforderungen – nicht nur physischer Art, sondern auch im Hinblick auf Konzentration, Arbeitsgeschwindigkeit oder Kommunikationsformen.
Deshalb ist es wichtig, dass das Arbeitsumfeld flexibel ist: Aufgaben sollten im eigenen Tempo erledigt werden können, unterstützt durch digitale Werkzeuge, die Kommunikation erleichtern (z. B. asynchrone Formate) und technologische Barrieren reduzieren (z. B. Sprachsteuerung, Automatisierung).
Aus meiner Erfahrung weiß ich: Kein Tool ersetzt echte Empathie und Engagement seitens der Führungskräfte und Teams. Entscheidend ist der Aufbau einer Kultur, in der sich alle gesehen und unterstützt fühlen. Verhaltensregeln im Umgang mit Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, regelmäßige Schulungen, Konsultationen und praxisnahe Szenarien helfen, Vorurteile abzubauen und Vertrauen aufzubauen. Besonders wirksam sind:
- universelles Design bei der Arbeitsplatz- und Prozessgestaltung,
- partnerschaftliche Einbindung betroffener Mitarbeitender,
- klare Kommunikation über Regeln und Zusammenarbeit,
- regelmäßige Schulungen, Support- und Advocacy-Gruppen.
„Ich empfehle Unternehmen, das Prinzip des universellen Designs konsequent umzusetzen – also die unterschiedlichen Bedürfnisse schon bei der Planung von Arbeitsplätzen und Prozessen zu berücksichtigen“, sagt Joanna Ślebioda, Expertin für Diversity, Inclusion und Barrierefreiheit.
Dank ihrer persönlichen Erfahrungen mit Zerebralparese und ihrer fachlichen Expertise bietet sie eine einzigartige Perspektive und inspiriert Unternehmen, stereotype Denkmuster zu überwinden und nachhaltige Lösungen für die Integration von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen umzusetzen.
Phygital – das neue Arbeitsmodell
Das „Phygital“-Modell, das physische und digitale Welten verbindet, war lange Zeit vor allem im Handel oder Marketing verbreitet. Heute wird es zu einem realen Organisationsmodell – insbesondere im Kontext von Inklusion. Durch Technologie entstehen hybride Arbeitsumgebungen, die sich flexibel an die Bedürfnisse der Teams anpassen – unabhängig von Wohnort, Gesundheitszustand oder Kommunikationspräferenzen.
Das Büro verschwindet nicht, verliert aber seine ausschließliche Rolle als Ort der Arbeit. Es wird vielmehr zum Zentrum für Begegnung, Integration und Zusammenarbeit. Die tägliche Arbeit – besonders in digitalen Bereichen – kann vollständig remote erfolgen, in einem Rhythmus und Umfeld, das zu den individuellen Möglichkeiten passt.
Technologie bietet konkrete Hilfsmittel für Menschen mit verschiedenen Behinderungen:
- Tools für asynchrone Kommunikation bei Sprach- oder Reizverarbeitungsproblemen,
- unterstützende Software für Personen mit eingeschränkter Mobilität (z. B. Sprachsteuerung, Automatisierung),
- Systeme zur besseren Aufgabenverteilung nach realen Fähigkeiten statt starren Rollen.
Ein richtig implementiertes phygitales Modell sorgt dafür, dass Wohnort oder physische Präsenz keine Voraussetzung mehr für berufliche Teilhabe sind.
Der neue Businessstandard: Zugänglichkeit und Gleichberechtigung
Die wichtigsten Trends zeigen, dass Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion (DEI) zunehmend Einfluss auf Innovationskraft und wirtschaftlichen Erfolg nehmen – in Polen ebenso wie in Europa. Viele Unternehmen schreiben DEI bereits als strategische Priorität fest, auch wenn die praktische Umsetzung noch Zeit braucht.
Ein gutes Beispiel ist EY Polen, das das Neurodiversity Center of Excellence gegründet hat – ein Programm zur Förderung und Rekrutierung neurodiverser Menschen in Zusammenarbeit mit der Stiftung AsperIT. Das Zentrum schafft ein inklusives Arbeitsumfeld für Menschen im Autismus-Spektrum oder mit ADHS, bietet angepasste Onboarding-Prozesse, Managertrainings und technologische Unterstützung. Dadurch werden zunehmend neurodiverse Fachkräfte in Teams für Cybersicherheit und Datenanalyse integriert.
Das erste EY NCoE entstand 2016 in den USA, seit 2021 gibt es auch in Polen ein erfolgreiches Pendant, das Menschen in Bereichen wie neue Technologien, KI oder Blockchain aktiviert. Solche Initiativen zeigen, dass Inklusion weit über körperliche Behinderungen hinausgeht und ein breites Spektrum einzigartiger Talente umfasst.
Moderne Technologien fördern Inklusion sowohl im HR-Bereich (automatisierte Rekrutierung, personalisierte Lernplattformen) als auch im physischen Umfeld. Phygitale Lösungen ermöglichen es, Arbeitsumgebungen individuell anzupassen. Unternehmen wie EY, Accenture, Wells Fargo oder SIG setzen auf KI-Agentensysteme, Remote-Onboarding und Assistenztools – von Custom-UX über Sprachassistenten bis hin zu emotionaler Nutzeranalyse.
SIG geht über klassische ESG-Ansätze hinaus. Das Unternehmen prägt nicht nur Trends im B2B-E-Commerce, sondern gestaltet aktiv moderne, inklusive Arbeitsplätze – und eröffnet Menschen mit Behinderungen einen realen Weg zur vollen Teilhabe an einer neuen, digitalen Wirtschaft, in der Technologie und Inklusion Hand in Hand gehen.